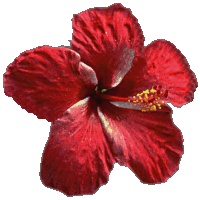Bericht von einer faszinierenden Reise nach Nicaragua
Von Matthias Schippel, ev. Pfarrer, Ehe- und Lebensberater
1. Die Ausgangslage
Ich fahre nach Nicaragua, weil ich mit meinen Freunden Monika und Michael Höhn das von ihnen gegründete Ometepe-Projekt kennenlernen möchte, über das sie mir immer erzählt haben. Ich wollte schon lange den lateinamerikanischen Kontinent kennenlernen, weil mich die Kultur und besonders auch die Musik fasziniert haben. Mein langjähriger Wunsch, nach Brasilien zu fahren, ließ sich leider nicht verwirklichen. Nun eben die Möglichkeit, nach Nicaragua zu fahren mit mir lieben Menschen. Innerhalb von 2 Wochen war die Entscheidung gefallen, nachdem mich Monika und Michael bei einem Treffen spontan fragten, ob ich nicht Lust hätte, in diesem Jahr im Juni mit ihnen und Anke Gross nach Nicaragua zu fliegen. Presbyterium, Superintendent und Leiter der Beratungsstelle stimmten in einem für mich erstaunlichen Tempo zu, und so konnten wir Anfang Januar den Flug buchen.
Was mich erwartete und mit welchen Erwartungen ich fuhr, ist nicht so einfach zu sagen. Wirkliche Armut und Maßnahmen dagegen vor Ort kennen zu lernen wäre vielleicht ein Motiv, aber etwas zu kurzschlüssig. Das Kennenlernen einer völlig anderen Kultur und Lebensweise und auch der Art und Weise, wie Menschen mit ihren Problemen umgehen oder sie zu lösen versuchen, wäre schon treffender. Darüber hinaus ging es mir auch darum, das Bewusstsein zu schärfen, sich auch klar über Wichtiges und weniger Wichtiges zu werden im alltäglichen Leben. Eine gewisse Trägheit und Gewohnheit zu durchbrechen, die sich im gewohnten Leben mit all seinen Bequemlichkeiten und Gewohnheiten einschleichen. Und so fuhr ich los, gespannt, was mich erwarten würde.
2. Nicaragua und Ometepe
Nicaragua ist ein kleines Land in Mittelamerika, das zweitärmste nach Haiti. Managua ist die Hauptstadt, dort leben auch die meisten Menschen. Der Norden ist bergig, der Süden eher flach und voller fruchtbarer Ebenen. Ein Teil des Landes liegt an der pazifischen Küste. Innerhalb des großen Nicaragua-Sees liegt die Insel Ometepe mit zwei großen Vulkanen, mit den schönen Namen Concepción und Maderas. Auf der Insel, die von der Hafenstadt San Jorge (Rivas) mit einer einstündigen Schiffsfahrt zu erreichen ist, leben ca. 35000 Menschen, die meisten in sehr ärmlichen Verhältnissen, d.h. in kleinen Hütten, oft mit drei Generationen und vielen Kindern unter einem Dach und einem Raum mit notdürftig abgetrennten Schlafstellen, in schlichten Betten, in denen meist mehrere Menschen schlafen. Es gibt eine Art Küche, das ist ein Teil der Hütte, mit einer Feuerstelle, auf dem mit Holz Essen zubereitet wird, in einem großen, rußgeschwärzten Kochtopf, in dem stundenlang Reis gekocht wird, der die Familie ernähren muss. Manchmal gibt es dazu Bohnen, das heißt dann „gallo pinto“, ein in Nicaragua beliebtes Gericht, oder auch gebackene Bananenscheiben, die satt machen. Bananen gibt es viele auf Ometepe, ebenso wie Früchte, z.B. Mangos oder Melonen. Der Reis wird von denen gekauft, die kein Stück Land zum Anpflanzen haben.
Es gibt viele Kinder in Nicaragua und auf Ometepe, die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt. Es gibt auch viele Tiere. Überall laufen Hunde, Schweine, Hühner herum oder auch Rinder und Pferde. Man sieht ihnen an, dass sie unterernährt sind, sie suchen Nahrung ebenso wie die Menschen. Das Klima ist in der Regel schwülwarm oder auch heiß, besonders in der Trockenzeit im Frühjahr und Ostern (um die 40 Grad). Im Juni beginnt die Regenzeit, der sehr heftig werden kann und manche Reisernte schlicht wegspült. Wenn es regnet, frieren viele Menschen, auch wenn es 30 Grad warm ist Sie husten, und besonders die kleinen Kinder werden dann zum Arzt gebracht. Die meisten „Nicas“ sind katholisch, die traditionelle christliche Religion Lateinamerikas. Es gibt aber auch protestantisch-fundamentalistische Gemeinden, sichtbar in kleinen Kirchen am Wegesrand. Auch die Zeugen Jehovas sind auf Ometepe mit 3 kleinen Kirchen vertreten. Die katholischen Nicas feiern besonders Weihnachten und Ostern, letzteres eine ganze Woche lang, mit großen Prozessionen, bei denen Jesus, Maria oder heilige Patrone durch die Strassen getragen werden. Fronleichnam erleben wir eine solche Prozession in der Stadt Altagracia.
3. Das Ometepe-Projekt
Das Ometepe-Projekt gibt es seit 1993. Das Zentrum befindet sich in dem kleinen Ort Santo Domingo am Ufer des Sees. Der Ort ist inzwischen auch touristisch erschlossen. Es besteht aus einer Schule mit Vorschul- und Grundschulunterricht, einem Physiotherapiezentrum für behinderte Kinder, einem kleinen ärztlichen Zentrum mit Zahnarztpraxis und Praxis für Allgemeinmedizin. Eine Psychologin kümmert sich um seelische Nöte. Das Ometepe-Projekt baut auch kleine Häuser für Familien in Not auf der Insel, inzwischen sind es 155, oder unterstützt eine Genossenschaft für die Vergabe von Kleinkrediten. Es hilft auch bei Bildungs- und Ernährungsprojekten und unterstützt Studenten aus Ometepe mit Stipendien. Das alles mit rund 100.000,00 € Spenden im Jahr aus Deutschland. Im Folgenden nun mein Reisebericht, in Auswahl, der einen Teil der Arbeit des Projektes sichtbar macht.
1. Tag
Wir gehen von der Quinta Monika, wo wir wohnen, die wenigen Schritte zum Zentrum des Ometepe-Projekts. Auf einem Schild steht dort „Clinica la Esperanza“ (Hoffnung).
Aus einem länglichen, flachen Gebäude dringt fröhliches Kinderlachen. Es ist die Schule mit zwei kaum schalldicht voneinander getrennten Räumen. In dem einen befinden sich 15 Kinder in blütenweißen Hemden und blauen Hosen oder Röcken, süße Kindergesichter mit tiefbraunen Augen, dunklen Haaren und besonders schöner hellbrauner Haut. In einer der Klassen unterrichtet Mercedes, eine zierliche Person, die aber mit lauter Stimme ihre Klasse dirigiert, eine Vorschulgruppe, im Raum daneben ist die 1. Schulklasse.
Nebenan ist das Physiotherapiezentrum mit dem männlichen Leiter Alvaro Sandoval und 3 weiblichen Hilfskräften. Wir werden fröhlich und warmherzig begrüßt. Mehrere Mütter mit behinderten Kindern sind in dem Raum, einige warten noch davor, alle haben Termine. Die Kinder werden unterschiedlich behandelt – die Kleineren auf einer Matte, neben den Kindern sitzt eine Therapeutin, die sich mit den Kindern beschäftigt und sich gleichzeitig mit den Müttern unterhält, die die Zeit zum Gespräch nutzen, das den anstrengenden Alltag unterbricht. Einige größere Kinder mit Lähmungen werden auf eine Liege geschnallt und aufgerichtet, anscheinend, um die Muskulatur zu stärken. In einem anderen kleinen Gebäude nebenan arbeitet die Zahnärztin Dr. Melida Luna, in einem engen Raum mit einem altertümlichen Zahnarztstuhl und mit Hilfe einer jungen Assistentin. Sie behandelt gerade eine Frau. Sie sagt, dass sie nicht nur im Notfall Zähne zieht, sondern auch Vorsorge betreibt. Auch ein Bohrer steht ihr zur Verfügung, den ein Zahnarzt in Europa wohl kaum mehr benutzen würde.
Nebenan arbeitet Dr. Roberto Alvarado in einem ebenso kleinen Raum. Eine Mutter sitzt dort mit einem Jungen, der Arzt hört seine Brust ab. Es ist eine typische Bronchitis, durch den Rauch vom Kochen in den Hütten, erklärt uns Dr. Alvarado. Er verschreibt ein Rezept, mit dem die Mutter in der kleinen Apotheke des Projekts ein Medikament abholen kann. Sie zahlt einen geringen Beitrag, soviel sie eben kann, der Rest wird vom Projekt übernommen. Dr. Alvarado behandelt, soweit er kann, in schwereren Fällen muss er natürlich zu einem Facharzt oder in eine Klinik überweisen, die es nur auf dem Festland gibt. Die notwendigen Transportkosten übernimmt ebenfalls das Projekt.
2.Tag
Wir fahren 7 km in das Landesinnere zu der Mutter eines spastisch gelähmten Jungen, der an 3 Tagen in der Woche im physiotherapeutischen Zentrum behandelt wird. Dafür muss die junge Mutter, die von ihrem Mann wegen der Behinderung ihres Sohnes verlassen wurde, große Strecken zurücklegen, und das zu Fuß über abgelegene Strecken, ihren Sohn im Rollstuhl fahrend. Einen Teil der Strecke legt sie mit dem Bus zurück. Jetzt hat sie das Privileg, von Alcides, dem Projektleiter, mit dem Auto gefahren zu werden. Wir fahren mit. Über rumpelnde Strassen – das letzte Stück ist eher ein Feldweg und erfordert hohe Autofahrkunst – geht es zur Behausung. Sie liegt abgelegt im Grünen, von wilden Pflanzen und Sträuchern umgeben. Ein Stück Weltende. Das Innere des Hauses wird zum Schlüsselerlebnis. Ein Junge, ein Mädchen, eine ältere Frau mit Stock, ein Schwein, ein Hund und ein schlafendes Huhn sind zu sehen. Zwei Räume für Menschen, mit einfachsten Mitteln ausgestattet. Eine notdürftige Abdeckung im größeren Raum für die Schlafstellen. Rückzug oder Intimität scheinen es hier nicht zu geben. Im zweiten „Raum“, einer Art Küche als Bretterverschlag mit dürftiger Abdeckung aus Holz, eine Feuerstelle mit zwei dampfenden, rußgeschwärzten Töpfen, aus denen Dampf quillt. Aus einer Öffnung ragt eine Holzvorrichtung nach draußen, als Spüle gedacht, mit einfachen Näpfen aus Blech und Plastikbechern. Ein junges Mädchen, das uns fröhlich anlächelt, spült dort gerade. Sie ist hübsch und sauber angezogen, im Kontrast zu ihrer Umgebung.
Eine Armut, die verstört und sprachlos macht, wie kann man so täglich leben, wie fühlt man sich dabei? Was tut man den ganzen Tag ohne Bücher, Radio, Fernsehen und Ablenkung aller Art, die wir gewohnt sind? Wie können Menschen so leben und trotzdem freundlich lachen wie die Mutter von Oldemar, dem spastisch gelähmten Jungen, den sie in ein abgenutztes Holzbett gelegt hat? Mir treibt es die Tränen in die Augen, ich verlasse die Hütte. Dort steht eine Art sanitäre Anlage, genauer gesagt ein Quadrat aus einfachem mannshohem Holz mit alter Plastikplane dazwischen als Sichtschutz. Ich schaue hinein – in der Mitte eine rostige Tonne mit Wasser, ein Schlauch als Leitung. Eine Art Dusche, wird uns erklärt. Ich fasse es nicht. Aber wie soll man etwas fassen, das nicht zu fassen ist…
Am meisten aber beeindruckt mich das Lachen von Mercedes, dieser jungen, bildhübschen Frau, das echt und ungeschminkt ist. Ein Lachen, das so unabhängig wirkt von dem sichtbaren Elend. Das der Armut und Enge trotzt und sich ganz dem Leben und dem Sohn widmet, den sie liebt und den sie zur Behandlung schleppt, über Stock und Stein. Für sie wird aus Mitteln des Projektes ein kleines Haus gebaut nebenan, auf dem gleichen Grundstück, denn um ein Haus zu bauen, muss man ein Stück Land besitzen. So kann sie in ummittelbarer Nähe ihrer Familie wohnen, aber auch mehr für sich sein und geschützt, denn sie fühlt sich offenbar von dem Bruder ihres Mannes bedroht.
Als wir 2 Wochen später noch einmal vorbeikommen, ist das Haus fast fertig, aus Steinen und Metall gebaut. Als sie davon erfuhr, habe sie vor Freude geweint, erzählt sie. Ihr Sohn auch.
3.Tag
Auf einem Geländewagen stehend, mit Hand am Griff, schaukeln wir über Strassen, die zum Teil mit großen Steinen übersät sind, zu Esmeraldas Haus. Sie wohnt fast am Ufer des Ometepesees, damit sie aus dem See Wasser holen kann. Nach einer scheinbar endlosen „Strasse“ Richtung See – jedes normale Auto würde hier streiken – erreichen wir Esmeraldas Haus auf wildem, abgelegenem Gelände, einsam stehend. Eine muntere Kinderschar auf dem kleinen Verandavorbau, zum Teil in weißblauer Schulkleidung. Esmeralda sitzt in einem Schaukelstuhl, neben sich die Krücken, sie ist gehbehindert. Ein wunderschönes Gesicht, sie lächelt uns an, freut sich, Monika und Michael zu sehen. Im letzten Jahr sei sie mit ihren Krücken der Länge nach hingefallen, als sie uns zur Begrüßung auf matschig glattem Boden entgegenhumpelte, erzählt Michael.
Die Familienverhältnisse sind unübersichtlich, einige Kinder sind von Esmeralda, andere wiederum von der Mutter, die neben ihr steht. Esmeralda wurde vermutlich mehrfach von ihrem Stiefvater geschwängert, der sich aber anscheinend nicht mehr um die Familie kümmern kann, weil er fast blind ist. Mindestens 5 Kinder schlafen in einem Raum, ein Raum ist ungenutzt. Das Haus ist mit Mitteln des Projektes gebaut. Esmeralda und ihre Mutter lachen herzhaft, als sie darüber sprechen, warum sie diesen Raum nicht als Küche nutzen. Er sei so schön kühl, sagen sie.
Die eigentliche Küche ist ein Bretterverschlag rechts am Haus. Dort dampft wieder ein Topf mit kochendem Reis. Die Familie hat kein Einkommen, zurzeit ist kein Ernährer da. Im Garten wächst etwas, was man kochen kann, zum Beispiel Bohnen oder Bananen. Reis muss erst gekauft werden, anderthalb Pfund wird benötigt, um einen Tag eine Familie zu ernähren. Ein Pfund Reis kostet etwa 10 Cordoba (etwa 50 Cent). Ein campesino verdient täglich für vier Stunden bezahlte Arbeit 30 Cordoba.
Das Material für Esmeraldas Haus, das wie alle anderen etwa zweieinhalbtausend Dollar kostete, musste mühsam herangeschafft werden. Es sind etwa 14 Kilometer von Santo Domingo bis hierher nach San José del Norte in die Bananenplantage.
Die Entscheidung über einen Hausbau fällt Alcides, der Leiter des Projektes, mit einem Komitee. Sie wissen über die Verhältnisse Bescheid und haben eine Kriterienliste aufgestellt, wer für ein Haus in Frage kommt, z.B. die allein erziehende Frau mit 6 Kindern. Ansonsten gäbe es Streit und Neid, denn viele möchten solch ein Haus haben. Auch beim Besuch in Esmeraldas Haus beeindrucken mich wieder der Gegensatz von sichtbarer Armut und Fröhlichkeit der Menschen, besonders der Kinder.
Auf der Rückfahrt fahren zwei dieser Kinder mit. Sie haben nachmittags Schule und stehen mit uns hinten auf offenem Wagen. Sie freuen sich, dass sie die staubige Steinstrasse nicht zu Fuß gehen müssen. Mindestens 3 Kilometer. Jeden Tag, hin und zurück. Bei Wind und Wetter.
Auf der Rückfahrt besuchen wir noch Doña Paulita, irgendwo mitten auf der Insel, am Fuß des Vulkans Concepción. Sie lebt auf einem vergleichsweise großen Hüttengelände, hat Fernsehen. Sie ist um die 80 Jahre. Hat lange weiße Haare, zu einem Zopf gebunden. Sie ist so der Typ der „weisen Alten“ und hat viel erlebt, viele Menschen auf der Insel zur Welt kommen und sterben sehen. Jetzt ist sie an einer Grenze ihres Lebens angekommen. Sie erzählt Monika und Michael, die sie lange und gut kennt, dass sie spürt, wie ihre Kräfte nachlassen. Sie scheint sich auf ihr Sterben vorzubereiten. Sie ist Kräuterfrau und Künstlerin, schnitzt Kalebassen (Baumkürbisse) in den verschiedensten Formen, als Teller, Schälchen oder auch Rasseln, die ihr das Projekt schon seit Jahren abkauft. Sie will jetzt alles loswerden, breitet ihre Bestände auf einem Tischchen aus. Ich frage mich, wie viele Stunden sie daran gearbeitet haben mag. Jetzt ist es genug.
Monika und Michael kaufen alle ihre Kalebassen, Alcides rechnet zusammen und verpackt die Schnitzereien in Plastiktüten. Mir schenkt Doña Paulita eine Flasche mit langem Band. Ich bin gerührt. Das sind so die heiligen Momente auf dieser Reise. Eindrücke, die mich noch lange begleiten werden.
2. Woche
Gespräch mit der Psychologin Karla Varela
Ich treffe Karla, die als Psychologin im Projekt arbeitet und mit der ich mich austauschen möchte. Sonia aus Österreich, Hotelbesitzerin am Ort, ist als Übersetzerin dabei. Wir sitzen auf der Terrasse ihres Hotels, es gibt starken Kaffee.
Karla erzählt von ihrer Arbeit. Dabei ist ihr Gesicht voller Lebendigkeit und Dynamik, ihre Augen strahlen, ihr breiter Mund erzählt und ihre Hände gestikulieren. Eine Frau mit Herz und Verstand, die eine schwierige Arbeit macht.
Ihre Arbeit besteht aus drei Bereichen:
Die erste ist Evaluation, d.h. sie testet Kinder, die ins Physiotherapiezentrum gebracht werden, ob sie für eine Behandlung geeignet sind. Sie arbeitet auch mit traumatisierten Kindern. Ich konnte sie bei ihrer Arbeit beobachten mit einem Jungen, der durch einen Krankenhausaufenthalt traumatisiert war. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Psychologie mit Kindern und Erwachsenen, zumindest auf Ometepe nicht. Ein zweiter Bereich ist ihre Sprechstunde, die in der Regel von Frauen besucht wird, von Müttern, deren Kinder gerade behandelt werden. Ein Gespräch dauert eine Stunde. Als besondere Problembereiche nennt sie häusliche Gewalt, aber auch Panikattacken oder generalisiertes Angstsyndrom und Depressionen. Sie hat auch eine Ausbildung in Traumatherapie gemacht, gelegentlich macht sie auch Arbeit in Frauengruppen und vermittelt Strategien gegen häusliche Gewalt.
Ihr Studium in Managua hat 5 Jahre gedauert, bis zum Diplom, sagt sie. Ich vermute, dass sie keine Therapieausbildung danach gemacht hat und frage auch nicht danach. Die Unterscheidung Beratung und Therapie gibt es nicht in Nicaragua. Ein solch segmentiertes System kann sich ein armes Land wie Nicaragua nicht leisten. Gespräche sind eben „terapia“. Karla ist die erste Psychologin, die auf Ometepe arbeitet. Ein dritter Bereich ist das Aufsuchen von Familien, in denen Probleme wie Depression, Suizidalität oder Gewalt herrschen. Dorthin kann sie nur in begrenzten Fällen, und sie gibt bis zu fünfzehn Mal als durchschnittliche Besuchszahl an. In der Familie spricht sie mit allen, die sie antrifft. Aber es kann auch sein, dass die Männer sich verdrücken, wenn sie sehen, dass sie kommt. In einzelnen Fällen arbeitet sie mit der Polizei zusammen und zeigt Männer wegen Gewalt an.
Wenn man so will, ist Karla „Mädchen für alles“, und sie amüsiert sich ein wenig, als sie von unseren fachlichen Unterscheidungen hört. Das wäre in ihrer Praxis ziemlich absurd. Sie kennt aber auch ihre Grenzen und verweist Menschen in Fällen von schwerer Depression o.ä. an Ärzte zur Behandlung. Für sich selbst hat sie regelmäßig Gespräche mit einem Professor ihrer ehemaligen Uni.
Sie ist ein fester Bestandteil des Gesundheitssystems auf Ometepe, und ihre Arbeit repräsentiert etwas von dem, was sich mit dem Namen „Esperanza“ (Hoffnung) verbindet.
3. Woche – Besuch in San Pedro
Am drittletzten Tag unserer Reise machen wir uns auf den Weg nach San Pedro, das liegt am äußersten Ende der Insel, hinter dem Vulkan Maderas. Es ist eines der ärmsten Dörfer Ometepes. Um dorthin zu gelangen, muss man um den Vulkan herumfahren, auf unwegsamen Strassen, die noch unbefahrbarer sind als bisher. Wir rumpeln über Steine, Querrinnen und abschüssige Teilstrecken mit Kuhlen, durch die man ganz langsam fahren muss. So werden wir durchgerüttelt, kommen aber vorwärts und sind nach anderthalb Stunden, ca. 25 km, da. Die Hütten werden bei der Fahrt immer ärmlicher, aber es gibt jede Menge Grün, Felder mit großen Stauden, mit Reis, Mais oder Bananen, riesige Bäume, die Schatten spenden.
Das Ambulanzteam ist schon da und wartet auf uns. In einem kleinen Gebäude, das als medizinischer Standort vom Projekt gebaut wurde anstelle einer einfachen Hütte, behandelt Dr. Alvarado die dort schon wartenden Frauen. Vergangene Woche konnten sie dort keinen Arzt treffen, das Team konnte wegen zu starker Regenfälle nicht fahren. Sonst fahren sie jeden Dienstag. Karla und Rosario, eine Sozialarbeiterin, wollen mit uns zwei Familien besuchen. Wir teilen uns in zwei Dreiergruppen und fahren wieder eine längere Strecke. Karla, Michael und ich besuchen eine Familie, in der es erblich bedingte Probleme mit Depressionen gibt und die Karla behandelt hat. Eine fröhliche Frau mit 5 Kindern empfängt uns, von Depression ist nichts zu spüren. Ich erfahre, dass es um ihren Mann und seine Familie geht, zwei seiner Brüder haben schon Suizid begangen, er selbst war nahe dran, es ging ihm oft schlecht. Karla hat Gespräche besonders mit Ehefrau und Mutter geführt, um Verständnis dafür zu wecken und bei Umgang mit depressiven Schüben zu helfen. Es gelang aber auch, ihn an einer Art Ritual zu beteiligen, bei dem er auch weinen und reden konnte. So wurde die Bedrohung für alle geringer. Der Mann kommt am Ende unseres Gespräches auch dazu, lacht und bedankt sich. Mir fällt auf, dass der Humor eine große Rolle beim Umgang mit Problemen spielt, auch und gerade bei seelischen. Besonders Karla lacht gerne und viel. Auf dem Rückweg von der Hütte erklärt sie uns genauer ihr Vorgehen bei ihren Gesprächen in Familien. Es gibt ein erstes Gespräch von etwa 30 Minuten, dann wird das Problem der Familie herausgearbeitet.
Die drei wesentlichen Problembereiche sind Suizid bzw. Depression, Alkohol und violencia (Gewalt). Dann folgen Gespräche (comunicación) über die genannten Problemthemen. Wichtig ist, dass es einen „compromiso“ (Vereinbarung) gibt. Es kann auch vorkommen, dass nach zwei Besuchen die Behandlung abgebrochen werden muss, weil keine Kommunikation zustande kommt.
Die Methoden sind mir vertraut, die Umstände allerdings sind völlig andere. Es müssen Schwellen und Hindernisse, wie lange Wege, überwunden werden. Manchmal ist bei Karlas Ankunft das Haus leer, Telefon gibt es natürlich nicht. Am Ende fahren wir noch bei einer Familie vorbei, in der vor kurzem eine junge Frau mit 29 Jahren verstorben ist, Mutter von 4 Kindern. Zwei Söhne haben sich in der Familie schon mit Pflanzengift umgebracht. Wie kann man damit leben, frage ich Michael bei der Rückfahrt. Weiterleben, sagt er, ein Wort von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie. Überall gibt es lebende Menschen, die der Zuwendung und Fürsorge bedürfen. Keine Zeit für lange Trauer- und Therapieprozesse. Wohl auch nicht für Sinn- und Identitätskrisen, die Wohlstandsneurosen unserer Gesellschaft, die in gepflegten Therapieräumen behandelt werden. Hier geht es jeden Tag darum, zu überleben, Menschen mit dem Notwendigsten am Leben zu erhalten. Wie wertvoll, dass es trotzdem medizinische und sogar psychologische Hilfe durch das Ometepe-Projekt gibt.
Portrait : Berta – Eine ungewöhnliche Frau
Berta ist unsere Haushälterin. Sie arbeitet mit Leidenschaft, ob es ums Kochen, Waschen oder Gräben ausschaufeln geht. Morgens um halb sieben kommt sie ins Haus, kurz nachdem wir unseren Morgenkaffee getrunken haben. Sie sagt „Hola“ – Hallo, der übliche Gruß. „Que tal?“ (Wie geht es?). „Bueno“, sage ich, da ich sonst kein Spanisch kann. „Bueno“ bekräftigt Berta, lächelt zufrieden und verschwindet in der Küche, um ein saftiges Frühstück zuzubereiten.
Sie hat ein Gesicht, das voller Stolz und Anmut ist, besonders, wenn sie lächelt. Alcides sagt, sie sei einmal die schönste Frau der Insel gewesen. Wenn man Bertas Töchter sieht, glaubt man das ohne weiteres. Berta hat sich vor kurzem taufen lassen. Sie gehört einer evangelischen Gemeinde an, wie es sie inzwischen häufig in Lateinamerika gibt, oft fundamentalistisch und von den USA ausgehend. Sie zeigt uns stolz ihre Taufurkunde, die schön bunt ist. Berta ist traurig, weil sie einige persönliche Sorgen hat, die sie nur Monika und Michael erzählt.
Wir unterhalten uns über den in Lateinamerika weit verbreiteten Machismo. Und so ist es durchaus üblich in Nicaragua und anderswo, dass ein Mann Kinder von mehreren Frauen hat und trotzdem bei einer lebt. Berta sagt, das dies nicht in ihr Weltbild und zu ihrem Glauben passt. In anderer Hinsicht ist Berta durchaus progressiv. Sie erzählt, dass sie Männer mit einer Machete aus ihrer Hütte treiben würde, wenn sie ihren Töchtern zu nahe kommen sollten. (Inzwischen sind 2 ihrer 3 Töchter mit anderen Männern zusammen und haben Kinder.) Berta findet das offenbar nicht so toll, weil sie fürchtet, dass sie von den Männern zu sehr beeinflusst und dominiert werden.
Ihre Tochter Flor besuchen wir auf dem Weg nach San Pedro. Sie ist zwanzig, ihr Mann 18 Jahre. Er hat verlangt, dass sie im Haus seiner Eltern wohnen. Flor ist glücklich, sie hat gerade ein kleines Mädchen bekommen. Wenn es nach dem für Frauen üblichen Lebenslauf geht, wird sie bald ein zweites und drittes bekommen. Dann ist sie vom Mann zunehmend abhängig und kann ihren Unterhalt nicht durch eigene Arbeit verdienen. Das heißt auch, dass sie keinen Beruf lernen kann, obwohl sie einen Schulabschluss hat.
Isania, die älteste Tochter von Berta, ist 26 Jahre und geht einen anderen Weg als ihre Schwestern. Sie ist von blendender Schönheit und sitzt eines Morgens bei uns am Frühstückstisch. Nach einem Touristikstudium lebt sie zuhause bei Berta, da sie keinen Job gefunden hat und lieber bei ihrer Mutter lebt. Am liebsten würde sie Ärztin werden, lässt sie durchblicken, sie will keine Kinder, lässt keinen Mann an sich heran. Aber dann müsste sie noch einmal studieren. Mit der Förderung des Projektes? Das muss die Zukunft bringen. (Mittlerweile gibt es eine deutsche „Patenschaft“ für Isania, die ihr ein Medizinstudium ermöglichen wird.)
Zwei Töchter, zwei ganz verschiedene Lebensläufe, wie sich jetzt schon zeigt. Berta ist stark und selbstbewusst und hat sich durch ihre Arbeit in der Quinta Monika einen bescheidenen Wohlstand geschaffen, in der sie seit 15 Jahren tätig ist. Ich habe sie ins Herz geschlossen.
4. Teil : Fazit und Reflexion
In meinen Göttinger Studienzeiten habe ich mich in meinen letzten Semestern intensiv mit der Befreiungstheologie in Lateinamerika und auch in Deutschland beschäftigt. Ich habe lateinamerikanische Autoren gelesen wie Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff oder auch Dom Helder Camara, die in Brasilien, Mexiko und anderswo unter den Ärmsten der Armen gewirkt haben. Aber auch deutsche Theologen wie Helmut Gollwitzer, Dorothee Sölle oder Johann Baptist Metz, über den ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, gehörten zu den von mir gelesenen Schriftstellern. Was hat mich daran fasziniert? Dass das Evangelium für die Armen in Theorie und Praxis dort wie hier unmittelbar und sichtbar umgesetzt wird durch erkennbare Zuwendung, durch seelsorgerliche und psychosoziale Arbeit, aber auch durch politische Aktionen und Kampf gegen die Herrschenden.
Ich habe den Begriff der strukturellen Sünde kennen gelernt, der bedeutet, dass die ungerechte Verteilung von Armut und Reichtum, die in Lateinamerika noch viel extremer ist als bei uns, und die Verwehrung des Zugangs zu materiellen und kulturellen Ressourcen für viele Menschen eine Sünde ist, die die Bibel und auch Jesus – besonders im Lukasevangelium – auch genau so benannt und gemeint haben.
Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass der Kampf gegen eine solche Ungerechtigkeit und die sie stabilisierenden Herrschaftsformen zutiefst notwendig und geboten ist, mit theologischen und gewaltfreien Mitteln. Ich glaube auch – und leide daran -, dass eine bürgerliche, unpolitische Theologie, wie ich sie hierzulande oft antreffe und an der ich auch beteiligt bin, keinen Sinn macht und am Evangelium Jesu vorbeigeht. Durch das Ometepe-Projekt habe ich, sicher im kleinen Maßstab, ein lebendiges, von Befreiungstheologie inspiriertes Projekt kennen gelernt. Dafür bin ich sehr dankbar. Das beginnt schon mit den Initiatoren Monika und Michael Höhn, die von dieser Theologie inspiriert sind.
Es setzt sich fort bei den Menschen, die im Projekt arbeiten und seine Hilfe in Anspruch nehmen. Sie sind durch ihren Glauben zu praktischen Taten der Liebe bewegt worden oder nehmen Hilfe ausdrücklich als im Namen Gottes geschehene an.
Ein wichtiger Schlüsselbegriff ist das Wort „Hoffnung – Esperanza“. Hoffnung bedeutet auch, zunehmend fähig zu werden, aus eigener Kraft die Probleme in die Hand zu nehmen und wenigstens teilweise bewältigen zu können. Das bedeutet Überwindung elementarer Not auf den Ebenen Gesundheit, Ernährung, Wohnen, aber Gewalt und Machismo. Dazu bedarf es vieler Anstöße und Hilfe von außen. Die leistet sichtbar das Ometepe-Projekt wie viele andere in Lateinamerika durch Bildung, Aufklärung, gesundheitliche Hilfe und Ernährungsprogramme. Es braucht viel Liebe und Geduld bei der Arbeit im Projekt, in der Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort, bei Missverständnissen, Konflikten und Rückschlägen.
Ohne Liebe und Hoffnung würde auch der Glaube nicht viel bringen auf Ometepe. Diese drei wirken zusammen, ganz im biblischen Sinne. Das ist Befreiungstheologie im ursprünglichen und echten Sinne, und das kann man spüren und sehen, wenn man da ist, auf Ometepe.
„Wer Ohren hat zu hören, und Augen hat zu sehen, der sieht mit Gewissheit Zeichen der Hoffnung“
Dom Helder Camara, brasilianischer Bischof